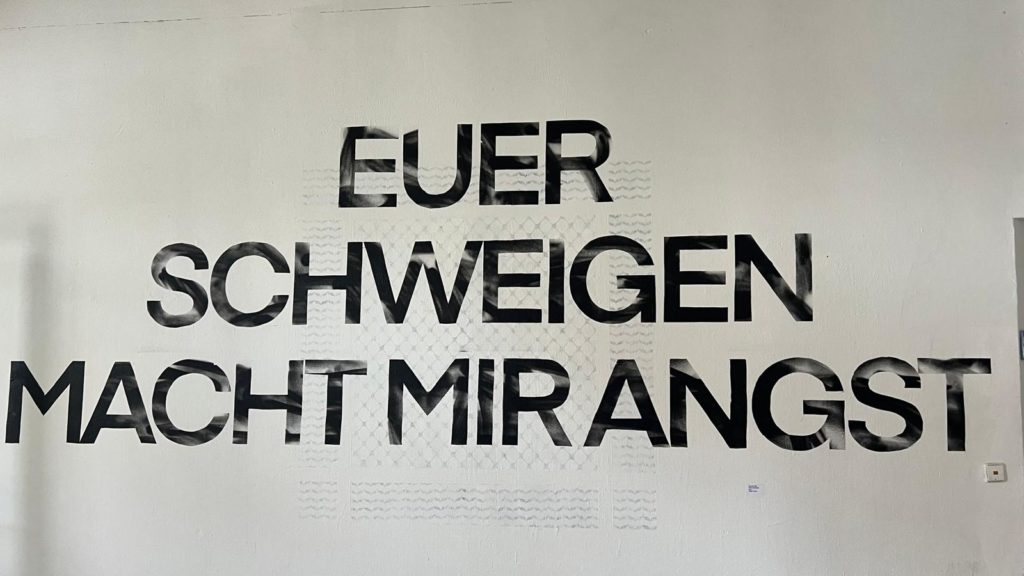Unser Aufnehmen begann mit einem Wechselspiel zwischen Stadt und Natur, zwischen Berlin und Stuttgart, zwischen Beobachtung und Intervention. In Berlin haben wir durch Umherstreifen, Sammeln und Dokumentieren ein Spannungsfeld entdeckt: Park – Stadt – Park – Stadt. Im Grünen erleben wir Ruhe, Entschleunigung, Weite. Die Stadt hingegen konfrontiert uns mit Hektik, Geschwindigkeit, Verdichtung. Diese Gegensätze spiegeln sich in unserem Video: rasende Zeitraffer der S-Bahn stehen im Kontrast zu stillen Nahaufnahmen von Pflanzen. Ein Rhythmus der Extreme – und ein Hinweis darauf, dass urbane Räume mehr erzählen als reine Funktionalität.
Mit dieser Ansammlung an Erfahrungen kamen wir nach Stuttgart und begannen zu fragen: Was ist das Menschenfeindlichste an der Stadt? Da uns schon in Berlin gerade die Orte die am meisten Verdichtet sind, an welchen sich nicht mehr alle Menschen aufhalten wie in Parks sondern nur die „zugehörigen“ sehr ins Auge gefallen sind, weil wir die meiste Zeit im grünen verbracht haben. Unser Blick fiel auf defensive Architektur – Gestaltung, die vertreibt statt einlädt, die Kontrolle ausübt, statt Begegnung zu ermöglichen. Aus diesem Impuls heraus entstand der Wunsch, diese unsichtbare Gewalt sichtbar zu machen – durch eine künstlerische Intervention. Wir lasen: Critical Care, Wann beginnt temporär, Zusammen Leben. Die Texte führten uns zu einer tieferliegenden Erkenntnis: Unser Wohlstand – unser Lebensstil – ist auf Ausbeutung gebaut. Die Erde und ihre menschlichen wie nicht-menschlichen Bewohner:innen sind zu Ressourcen geworden. Seit Jahrhunderten verwandeln sich Lebewesen in Müll, Beziehungen in Schulden.
Doch es gibt Alternativen. Schon in Berlin sind wir auf die Gärten im Tempelhofer Feld gestoßen und waren begeistert. Daraufhin haben wir uns tiefergehend mit der Thematik auseinandergesetzt. Gärtnerische Praktiken öffneten für uns ein anderes Denken: Gärtnern als Sorge, als Beziehung, als Widerstand. Nicht als romantischer Rückzug ins Grüne, sondern als politischer, widersprüchlicher und realer Ort des Aushandelns. Wie die Philosophin Maria Puig de la Bellacasa schreibt, bedeutet Gärtnern, sich die Hände schmutzig zu machen – und dabei eine neue Form der Aufmerksamkeit zu entwickeln. Gärten sind keine Paradiese. Sie sind kontaminierte Räume, durchzogen von Geschichten, Kämpfen, Hoffnung und Verlust. Sie sind Räume des Teilens – zwischen Menschen, Tieren, Böden, Wurzeln, Winden. Und sie erinnern uns daran, dass wir nicht außerhalb der Natur stehen, sondern in ihr, mit ihr, durch sie leben. Dieser Fokus auf die gärtnerische Praxis eröffnete für uns einen neuen Weg die in Berlin gesammelten Erfahrungen nach Stuttgart zu bringen.
Die ersten Bauarbeiten begannen für das Neubau Besucher- und Informationszentrum Weissenhof. Wir haben uns innerhalb unseres Kollektivs und auch im Austausch mit den anderen Kollektiven mehr und mehr dabei beobachtet wie wir über diesen Neubau diskutieren. Uns viel auf das diese Thematik nicht so weit entfernt ist von unserem vorherigen Fokus auf defensive Architektur. Der Neubau wird den bisher offenen Campus der Akademie grundlegend verändern. Und wir stellten uns immer wieder die Frage: Wozu denn eigentlich dieses Informationszentrum dient?
Die Bauarbeiten schritten voran und der grüne eigentlich ungenutzte Bereich vor dem Künstlerbau begann uns mehr und mehr ins Auge zu fallen, da dieser ebenso von dem Bau betroffen sein wird. Innerhalb der Grünfläche gibt es einen kleinen betonierten Bereich.
Für uns die perfekt Möglichkeit mit unserem gesammelten Wissen und unseren Erfahrungen eine „Intervention“ zu starten. Wir begannen Erde aufzuschütten und Blumen zu sähen. Wir nutzen Materialien aus der unmittelbaren Umgebung um die den kleinen Erdhügel zu verschatten. Wir gossen den Erdhügel täglich mehrmals und bekamen somit mit was sich alles auf dem Grundstück so tut. Denn die Pflanzen um unseren Erdhügel wurden immer weniger und keiner konnte uns konkrete Auskunft geben, wann genau auch dieser grüne Bereich von den Bauarbeiten überlagert sein werden wird.
Wir ließen uns nicht davon abhalten und gossen weiter und beobachteten.
Unser Vorhaben:
Dort, wo Beton gegossen und Erde abgetragen wird, wollten wir etwas entgegensetzen: einen kleinen Erdhügel auf einem massiven Betonquader. Darauf: Mohnblumen – als Zeichen des Widerstands. Daneben: eine schlichte Bank, die einlädt, Platz zu nehmen, zu beobachten, zu verweilen. Ein minimaler Eingriff mit maximaler Bedeutung – als stille Geste gegen das Überrollen durch Bau und Wachstum. Doch die fortschreitenden Bauarbeiten machten das Gelände unzugänglich. Unsere Intervention konnte nicht umgesetzt werden.
Doch auch dieses Scheitern ist Teil unseres Prozesses. Und brachte uns noch mehr dazu unseren Prozess so ausführlich zu reflektieren. Es stellt neue Fragen: Was tun, wenn Räume verschwinden, bevor wir sie gestalten können? Wie intervenieren wir in einer Stadt, die keine Lücken lässt? Unsere Auseinandersetzung geht weiter – zwischen Beton und Erde, Konzept und Kompost, Mensch und mehr-als-menschlicher Welt. Wir erzählen von diesen Reibungen – in Bildern, Texten, Gesprächen – und bleiben wach für das, was wächst.